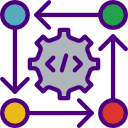Architektur und Wartbarkeit: Blick unter die Haube
Low‑Code erlaubt eigene Services, Hooks und Bibliotheken, die sauber versioniert und getestet werden. Dadurch bleiben Domänenlogik und Integrationen beherrschbar, auch wenn Anforderungen wachsen oder neue Systeme angebunden werden müssen.
Architektur und Wartbarkeit: Blick unter die Haube
No‑Code‑Regeln sind oft schwerer wiederverwendbar und bei Spezialfällen begrenzt. Komplexe Ausnahmen führen schnell zu verschachtelten Bedingungen. Planen Sie früh, wie Sie Regelwerke dokumentieren, vereinfachen und bei Bedarf in Low‑Code‑Erweiterungen überführen.